Für
die blitzartig einschiessenden Kopfschmerzen bei Vanessa findet der Arzt keine
Ursache. Das 13-jährige Mädchen ist kurzsichtig und hat Legasthenie. In der
Schule kommt sie aber einigermassen mit. Ihre Mutter leidet unter starken
Stimmungsschwankungen, der Vater ist ein Choleriker. Vor sechs Monaten war Vanessa
mit ihrem Onkel in einen Autounfall verwickelt, der Onkel ist dabei gestorben.
Das Mädchen kann mit niemandem darüber reden, sie hat nur einmal ihrer besten
Freundin davon erzählt. Der
Arzt schickt Vanessa für weitere Abklärungen zum Psychiater. Dieser
diagnostiziert eine Somatisierungsstörung. Vereinfacht gesagt: Vanessa kann
den Tod ihres Onkels nicht verarbeiten und reagiert mit Kopfschmerzen. Solche
Fälle sind typisch für Kinder und Jugendliche – seelische Leiden führen bei
ihnen oft zu körperlichen Symptomen. Und: Derartige Fälle sind nicht nur
typisch, sondern auch sehr häufig.
Immer mehr Kinder müssen zum Psychiater, Sonntagszeitung, 24.11. von Dominik Balmer
Eine
neue Auswertung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zeigt,
wie dramatisch die Zahlen in den vergangenen Jahren hochgeschnellt sind.
Beispielsweise bei den Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre, die sich in einer
Psychiatriepraxis behandeln liessen. Im Jahr 2006 waren es nur gerade 25
Kinder und Jugendliche pro 1000 Versicherte, 2017 bereits mehr als 41. Das ist
ein Plus von 65 Prozent.
Noch
deutlicher zeigt sich der Effekt bei den Konsultationen in der ambulanten
Spitalpsychiatrie. Von 2006 bis 2017 haben sich die Konsultationen bei den
Kindern und Jugendlichen mehr als verdoppelt – die Gesundheitsstatistiker
verzeichnen ein Plus von mehr als 120 Prozent. Bei manchen psychiatrischen
Ambulatorien müssen die Eltern mittlerweile bis zu sechs Monate warten, um
einen Termin für ihre Kinder zu bekommen.
Steigender
Leistungsdruck ist eines der Hauptprobleme
Natürlich
sind die Zahlen nicht nur ein schlechtes Zeichen. «Eltern, Lehrer und
Angehörige schauen heute genauer hin, wie es den Kindern geht. Das ist
positiv», so Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Zumal auch das Angebot an Psychiatern und Psychologen gestiegen sei. «Früher
gab es eine Dunkelziffer in der Statistik, diese ist heute sicher
tiefer.»
Da
ist aber auch die andere Seite. Der enorme Anstieg innert weniger Jahre hat
noch weitere Gründe. Weniger erfreuliche. Schweizer Kinder und Jugendliche sind
zwar so gesund wie seit Jahrzehnten nicht mehr – allerdings gilt das nur für
deren Körper. Ihre Seelen, die sind zunehmend krank.
Dagmar
Pauli ist Chefärztin der universitären Zürcher Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Als eines der Hauptprobleme bezeichnet sie den steigenden Schuldruck und die
Leistungsanforderungen an die Kinder. Und die Schweiz ist keine Insel: Laut
Pauli belegen internationale Studien, dass psychische Krankheiten wie
Depressionen und Ängste bei Überforderung im Kindes- und Jugendalter auch in
anderen Ländern häufiger diagnostiziert werden.
Für
Bilke-Hentsch, Präsident der Vereinigung kinder- und jugendpsychiatrischer
Chefärzte, ist die Digitalisierung einer der grossen Krankmacher. Der Arzt
spricht von einem «immensen Risiko» für eine Gesellschaft. Die Digitalisierung
löse bei den Erwachsenen «massive Unsicherheiten» aus. «Das überträgt sich auf
die Kinder. Und sie sind letztlich nichts anderes als ein Seismograf ihrer
Eltern.» Die Kinder würden sich fragen, ob sie in dieser Gesellschaft einmal
überhaupt noch gebraucht würden.
So
weiss man heute: Die zunehmenden Burn-out-Diagnosen bei den Erwachsenen prägen
ihre Kinder. Sie wachsen in einem stressig-labilen Umfeld auf. Die Kinder
leiden mit und werden später selber krank. Diese Prägung kann so weit gehen,
dass sie in deren Erbgut nachweisbar wird.
Immer
gibt es jemanden, der besser oder schöner ist
Als
zusätzlicher Brandbeschleuniger wirken die sozialen Medien und Netzwerke. Sie
sind überall verfügbar – und erlauben ständige Vergleiche. Immer gibt es
jemanden, der besser ist, schöner, mehr Follower hat und mehr Likes generiert.
Für Kinderseelen sind solche Vergleiche und Dauerbewertungen toxisch. «Studien
belegen, dass junge Menschen, die viel Zeit mit sozialen Medien verbringen,
wesentlich depressiver sind als andere», sagt Bilke-Hentsch.
Letztlich
sind es mehrere Faktoren, die zu einer Krise oder einer Krankheit führen. Stets
zentral aber ist die Familie. Alain Di Gallo, Direktor der universitären Klinik
für Kinder und Jugendliche in Basel, sagt: «Die Hirnentwicklung und die starke
Abhängigkeit aller Kinder und Jugendlichen von ihrem Beziehungsumfeld sind eng
mit der Symptomatik psychiatrischer Krankheiten verbunden.» Als typische
Störungen bezeichnet er Trennungsängste, Einnässen, Magersucht und ADHS.
Die
Lebensverweigerer sind überall gescheitert
Die
Psychiater sehen aber auch immer wieder neue Phänomene. «Es gibt
Lebensverweigerer, die sich abkapseln und nicht mehr zur Schule gehen wollen»,
sagt Psychiaterin Pauli. Dieser Schulabsentismus ist laut Pauli ein zunehmendes
Problem. Es seien oft Buben betroffen, gerade in Kombination mit exzessivem
Medienkonsum wie E-Sport-Games. Diese jungen Patienten sind überall
gescheitert: in der Schule, im Sozialleben, in der Liebe. Was sie können, das Gamen,
betreiben sie umso exzessiver.
In
der Psychiatrie lernen die Kinder und Jugendlichen vereinfacht gesagt, wie sie
ihre Probleme selber lösen können. Das soll sie wappnen für spätere Krisen.
Manchmal klappt das ohne Medikamente, manchmal braucht es sie.
Dass
es sich lohnt, sich so früh wie möglich mit der psychischen Gesundheit der
Kinder zu befassen, ist unter Experten ein Konsens. Viele bei Kindern und
Jugendlichen diagnostizierte Krankheiten würden im Erwachsenenleben
fortbestehen, sagt Psychiater Di Gallo. Und rund die Hälfte dieser Störungen
hätten ihren Ursprung vor dem 16. Lebensjahr.
Umso
fataler sind seelische Leiden bei Kindern und Jugendlichen, weil sie
Entwicklungsaufgaben hemmen: Für Babys und Kleinkinder sind das beispielsweise
Laufen- und Sprechenlernen, bei Kindern und Jugendlichen das Einschulen, die
erste Lehrstelle und die erste Liebesbeziehung. «Für Kinder gibt es keinen
Neustart. Deshalb müssen wir früh intervenieren», sagt Bilke-Hentsch.
Was
für die Fachleute logisch klingt, sieht die Politik zuweilen anders. Der
Spardruck auf die Psychiatrie ist immens. Dabei müsste das Gegenteil passieren,
wie Pauli fordert. «Wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer noch
eine Unterversorgung. Wir können nicht sparen. Wir müssen gerade bei den
frühen und ambulanten Hilfen ausbauen – und das kostet.»
«Wir
haben ein ernstes Nachwuchsproblem»
Auch
Bilke-Hentsch ist besorgt, dass sich wegen der steigenden Kosten der
Verteilkampf weiter akzentuieren wird. «Wir riskieren, dass künftig 10 bis 20
Prozent aller Schweizer Kinder und Jugendlichen schlicht abgehängt werden.»
Unter diesem hohen Druck verliere auch der Beruf des Psychiaters an
Attraktivität. «Wir haben schweizweit ein akutes Finanzierungs- sowie ein
ernstes Nachwuchsproblem, das wir zusammen mit der Politik dringend lösen
müssen.»
Die
Geschichte von Vanessa findet letztlich ein gutes Ende. In psychotherapeutischen
Sitzungen bewältigt sie die verdrängte Trauer und Wut. Sie besucht ein
Legasthenietraining, lernt Entspannungstechniken, treibt Sport. Gleichzeitig
erhalten ihre Eltern Unterstützung – und die Lehrer werden einbezogen. Nach
drei Monaten bezeichnet der Therapeut die Lage als stabil. Die Kopfschmerzen
sind weg.
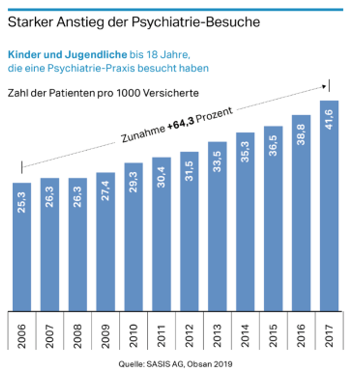
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen